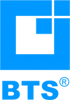ARTIKEL ZU SEELSORGE UND BERATUNG
Was der Mühlentag mit Erziehung zu tun hat
Wie kann eine gesunde, christliche Erziehung gelingen angesichts des Dschungels pädagogischer Heilsversprechungen? Und welche Auswirkungen hat dies auf die Gemeinde von morgen? Ein paar Gedanken von Lebensberaterin Doris Bürki.
Wenn Gemeinde gemein ist
Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Manchmal werden diese aber so dick, dass sie schon beinahe einen Keil treiben. Wie man trotz theologischen, strukturellen und zwischenmenschlichen Differenzen eine gesunde Gemeindekultur pflegen kann, zeigt der Gastbeitrag von Doris Bürki.
Verbaler Zehnkampf oder Worte des Friedens
Verletzende Worte im Netz äussern, diese Disziplin beherrschen auch Christen. Dabei gäbe es andere Wege, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, findet Doris Bürki.
Das Prinzip der Zuversicht
Im Grundkurs „Beratung für Kinder und Jugendliche“ habe ich zum ersten Mal vom Prinzip der Zuversicht von dem Psychologen Dr. Jörg Dieterich gehört und begonnen, mich damit auseinander zu setzen. In seiner neuen Publikation „Beratung kommt ohne Pädagogik nicht aus“ gibt er dazu einige Impulse. Für meine Arbeit braucht es eine ressourcenorientierte Haltung und auf jeden Fall Zuversicht.
Wenn ich eine Familie begleite und die „Intentionen“ und „Elementaria“, die Dr. Dieterich beschreibt, also meine methodischen und didaktischen Vorgehen auswähle, dann muss ich grundsätzlich zuversichtlich sein, dass mein Handeln in die richtige Richtung weist. Ich muss den Prozess mit den Klienten zuversichtlich gehen und daran glauben, dass die Menschen in der Lage sind Schritte zu tun. Es macht dabei für mich nicht nur Sinn zu neu Erlerntem anzuleiten und etwas zu „lehren“, wie es Dr. Jörg Dieterich beschreibt, sondern auch herauszufinden, wo der Klient anknüpfen kann, wo er sich rasch als selbstwirksam erfährt.
Diese Zuversicht ist nicht immer leicht zu generieren. Dr. J. Dieterich empfiehlt sie sich bei Gott zu „borgen“, damit sie langanhaltend, groß und gewichtig ist. Wie soll ein Ratschlag, ein Wert, ein Erziehungsziel usw. mit Zuversicht vorgetragen werden, wenn existenzielle Zweifel vorgelagert sind? (Zitat Buch S.126)
Ich arbeite im Vertrauen auf Gott mit meinen Klienten und der Glaube ist die Grundlage meiner Zuversicht in der Begleitung. Dabei geht es nicht darum naiv zu sein und zu denken, es wird schon werden. In meiner Begleitung muss ich genau hinschauen, ob die Hilfe zur Selbsthilfe angenommen wird, und ob die Klienten die Schwierigkeiten zum Wohl der Kinder angehen und lösen. Trotzdem geht es für mich um die grundsätzliche Frage, wem ich Zweifel und mögliches Scheitern, ja dieses Menschenleben und seine Zukunft letztlich anvertraue. Ich vertraue es Gott an, und ich glaube, dass er mein Handeln segnet und vor allem bei meinen Klienten bleibt.
Meine persönliche Zuversicht, dass ich mit Menschen beratend arbeiten kann, möchte ich mit einem Satz des Theologen Hermann Bezzel (1861-1917) beschreiben: „Nicht Satte können andere trösten, sondern Gespeiste, nicht Sichere können anderen die Not ihres Lebens sagen, sondern Gewisse, nicht Fertige können dem Volk sein tiefstes Elend schilden, sondern Gereifte.“
© Sabrina Bennewitz, Mai 2020
Kontakt: saone1@web.de
(Auszug aus ihrer Abschlussarbeit: „Die Allgemeine Beratung, Psychotherapie und Seelsorge in der Fall- und Beratungsarbeit der Jugendhilfe“
vollständige Arbeit nachzulesen unter: https://bts-ips.de/bts-intern/
Literatur: Jörg Dieterich „Beratung kommt ohne Pädagogik nicht aus“
Was Beratung in einer Gruppe wirklich ausmacht- ein unverzichtbares Tool für die Praxis
Von Lieselotte Beißwanger
Barbara, eine zurückgezogene, einfache Frau, Mitte vierzig, meldet sich auf Anraten des Psychiaters bei mir. Schnell stellt sich heraus, dass Barbaras Problematik mich vor immense Herausforderungen stellen wird. Ob ich mich dieser Beratung stellen soll? Solch tief eingeschliffenen Verhaltensweisen werden doch kaum veränderbar sein. Barbaras Umstände sind dermaßen desolat, dass mein Vorstellungsvermögen an seine Grenzen kommt. Jahrelang hatte sie gehofft, dass ihr alkoholkranker Partner mit dem Trinken aufhört. Ihr ganzes, bescheidenes Einkommen, ihre wenigen Beziehungen, ihr anspruchsloses Hoffen ist in all den Jahren aufgezehrt worden. Sie steht vor einem Trümmerhaufen und ist am Ende. Doch nicht so am Ende, dass sie nicht wieder anfängt, zu hoffen und sich wieder zusammenzureißen und wieder eine Schleife zu drehen. Es ist kaum Geld vorhanden, das Lebenswichtigste zu zahlen- geschweige denn eine Beratung.
Barbara kommt in die Gruppe. Ein Mensch, der sich nur über Defizite definiert, macht kleinste Schritte in ein unbekanntes Terrain- und erlebt Erfolge. Diese Erfolge sind bedingt durch die Gruppenteilnehmer, das hätte ich in der Einzelberatung überhaupt nicht leisten können. Barbara lernt, sich auch als ungeübte Rednerin zu äußern, sie lernt, ihre Scheu vor andern Stück um Stück zu überwinden und von den andern Gruppenmitgliedern Anerkennung anzunehmen. Sie hört aufmerksam zu, wenn andere von ihren Problemen erzählen und gibt unverhofft verblüffende Einsichten preis. Die andern lieben ihre Wärme. Sie fiebern mit ihr, wenn sie sich ein neues Auto kaufen muss. Sie stehen ihr mit ihrem Erfahrungswissen bei und geben dadurch solide Entscheidungsgrundlage. Es ist fast nicht zu glauben, Barbara geht den stetigen Weg einer gesunden Veränderung.
Warum erwähne ich diese Geschichte? Ich will damit aufzeigen, welche entscheidenden Veränderungsprozesse nur mit Hilfe des Gruppensettings ermöglicht werden.
Wöchentliche Termine machen den Beratungsprozess kontingent, Barbara besucht nun seit mehr als zwei Jahren regelmäßig die Gruppe und wird dadurch gestützt in ihrem neuen Verhalten. In der Einzelberatung wäre ihr und mir längst der Atem ausgegangen, ganz abgesehen von der finanziellen Überforderung.
Wenn ich als Berater freundliche, wertschätzende Worte sage, meint Barbara, das wäre ja schließlich meine Aufgabe. Wenn aber Gruppenteilnehmer dies tun, geht es ihr doch eher unter die Haut.
Wenn meine Erfahrungen mit Autokauf begrenzt sind, können andere mit ihrem Erfahrungshorizont einspringen, das gibt dem jeweiligen Teilnehmer auch das Gefühl von Kompetenz.
Isolierte Menschen erleben Rückhalt, Zusammenhalt und Getragenwerden, sie erleben aber auch, dass sie diejenigen mittragen können, die gerade bedürftig sind.
Ich könnte noch viel mehr anführen, was mich begeistert an der Gruppenarbeit; mit Manfred Siebalds Lied wird es treffend ausgedrückt: Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft, jeder kann mit seinen Gaben, das tun, was kein andrer schafft.
Gut, dass wir einander haben.
„Von Mann zu Mann – Erfahrungen aus einer BTS Gruppe“
Ich bin Gabriel, bin 27 Jahre alt und gelernter Maschinenbautechniker. Mit 22 Jahren habe ich an einer Bibelschule in Österreich teilgenommen. Die Bibelschule ging 9 Monate und war für mich eine sehr schöne Zeit und ich habe sie sehr genossen. Als ich dann zurück zu meiner alten Arbeitsstelle gekommen bin, kam schnell der Alltag wieder und ich habe an vielem gezweifelt. Die Schichtarbeit und der manchmal stumpfe Umgang unter Arbeitskollegen hatten mich frustriert. Ich habe gemerkt, dass meine Gesinnung immer schlechter wurde und ich mich immer mehr in mich selbst zurückgezogen habe. Ich wusste, etwas stimmt nicht mit mir und meine Arbeitskollegen haben das natürlich auch mitbekommen. Ich selbst habe mich nicht mehr verstanden und war sehr schnell aggressiv. Das wirkte sich so aus, dass ich mich bei meinen engsten Verwandten im wahrsten Sinne des Wortes “ausgekotzt“ habe.
Immer wieder sagte ich: Warum muss mir das passieren, warum muss ich das durchmachen und warum geht’s mir gerade so schlecht. Ich habe mich aufgeregt, den Grund dafür wusste ich nicht. Ich habe mich in die Nacht geheult, ohne einen Auslöser oder einen Grund zu finden. Teilweise habe ich auch nicht mehr schlafen können. Ängste, vor Freunden zu versagen hatte ich auch und von Gott und Jesus Christus habe ich nicht viel gespürt. Ich habe mich verlassen gefühlt von Jesus. Ich war auch körperlich kraftlos und habe viel Pausen benötigt.
Ich und auch meine Eltern wussten, dass ich jetzt etwas unternehmen muss. Dass ich therapeutische Hilfe benötige. Meine Eltern hatten schon früher einmal den Kontakt mit der biblisch therapeutischen Seelsorge (BTS). Gemeinsam haben wir entschieden, dass ich dort in die therapeutische Seelsorge gehen möchte. Um einfach das, was passierte und meine Probleme mit Schlaflosigkeit und Angstzuständen zu verarbeiten. Zuerst habe ich Einzelgespräche in Anspruch genommen. Diese dauerten immer 45 Minuten. Dort hatte ich den Raum, Dinge anzusprechen, die ich mit keinen anderen Personen teilen wollte. Jedes Thema, das mich belastete und mir Kraft und Lebensfreude raubte konnte ich ansprechen und mit dem Seelsorger gemeinsam besprechen und bereden. Es ging auch viel um den Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen. Um meinen eigenen Selbstwert. Den Unterschied wie mich Gott sieht und wie ich mich sehe. Wir haben gemeinsam Lösungen und Techniken für die Probleme erarbeitet und Themen besprochen die mir auf den Nägeln brannten.
Ich habe mich selbst dadurch nochmal tiefer kennengelernt und mich selbst wieder angenommen. Was für mich auch ganz arg wichtig war, dass ich Möglichkeiten erlernt habe wie ich mit Situationen umgehe, die sehr fremd für mich sind. Oder die mir Angst und Panik machen, oder vor vielen Menschen zu sprechen. Ich habe neue Ansichten zu Themen bekommen. Als Beispiel den Umgang mit meiner Sexualität. Ich dachte lange, dass mein Umgang mit meiner Sexualität eine Sünde ist und dass Jesus das gar nicht gefällt. Mittlerweile denke ich anders darüber. Denn der Teufel möchte uns am Boden sehen, Jesus möchte uns ermutigen. Das war ein wichtiges Thema für mich. Nach ca. einem halben Jahr hat mich der Seelsorger eingeladen, in seine Seelsorgegruppe zu gehen. Zuerst zögerte ich. Dann habe ich mich aber dennoch entschieden wenigstens einmal hinzugehen. Das Resultat davon war, dass ich ein Jahr lang die Gruppe besucht habe. In der Gruppe kann jeder Teilnehmer seine Anliegen einbringen und sie werden zuerst einmal gehört und verstanden. Sie werden nicht gewertet sondern man versucht gemeinsam in der Gruppe eine bestmögliche Lösung für die mitgebrachten Probleme zu finden. Jeder hatte seine persönlichen Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hatte. In der Gruppe war der Raum da, dass man diese Probleme nennen konnte ohne dumm dazustehen, wie es in manchen Kreisen ja der Fall ist.
Der Gruppenleiter ist in der Gruppe als Moderator tätig und bringt seine langjährige Erfahrung als therapeutischer Seelsorger und seinen Glauben an Jesus Christus mit in die Gruppe ein, was für jeden ein Mehrwert ist. Die Gruppe bietet auch Raum um Dinge auszuprobieren, in denen man sich noch nicht sicher ist. Oder wenn man selbst nicht weiß, ob die Idee gut ist oder schlecht. Die Gruppe hat mir Mut gemacht, wenn ich Ideen hatte die ich gerne umsetzen möchte, diese auch anzugehen und praktisch werden zu lassen. Ich selbst hatte die Idee auf einer Hochzeit von einem guten Freund ein Beitrag zu gestalten. Ich dachte daran einen Song zu dichten und diesen dann vor der Hochzeitsgemeinde in Form eines Rapps zu performen. Da ich das aber noch nie gemacht habe, habe ich den Song einfach in der Gruppe einmal vorgetragen. Die Gruppe hat sich den Song angehört und mir gesagt, dass der Song sehr gut war und dass man ihn bei einer Hochzeitsgesellschaft gut vortragen kann. Sie haben mich ermutigt, meine Idee Wirklichkeit werden zu lassen und dass ich ihn auf der Hochzeit von meinem Freund auf jeden Fall vortragen soll. Was ich dann auch gemacht habe. Mit Aufregung habe ich angefangen, dort den Rapp zu performen. Doch ab dem zweiten Vers habe ich dann sogar richtig Spaß gehabt.
Die Zeit in der Gruppe hat mir wieder die Freude am Leben gegeben. Ich bin nicht mehr unzufrieden mit mir selbst und fühle mich nicht mehr minderwertig. Sondern ich weiß, dass ich ein Mann bin der was kann. Der Wertvoll ist in den Augen Gottes.
Mit 24 ich habe die Gruppe verlassen mit zwei Zielen im Kopf. Zum einen hatte ich den Wunsch, mein Leben selbständig zu gestalten ohne die Gesprächsgruppe zu benötigen. Zum anderen wollte ich ein Studium zum Maschinenbautechniker absolvieren. Diesen Abschluss habe ich erfolgreich geschafft. Ich bin der Meinung, dass die Gesprächsgruppe ein wichtiger Teil dafür war, dass ich diese Ausbildung geschafft habe.
Noch heute wende ich Techniken an, die ich in der Gruppe gelernt habe. Als Beispiel, dass ich manche Probleme als nicht so groß einstufe, ihr die Bedeutung nehme und somit die Panik nachlässt, die im Kopf ansteigt.
Vielen Dank an den Lebens- und Sozialberater und an die Teilnehmer der BTS Gruppe.
Liebe Grüße
Gabriel
Kinder sind anders, Jugendliche auch – Neuer Kurs in 2018
Warum Kinder und Jugendliche eine besondere Beratung und Seelsorge brauchen.
Kinder sind anders. Jugendliche auch. Diese Erkenntnis ist zwar bekannt. Aber es ist eine ungenaue Aussage. Ungenaues Wissen erzeugt Unsicherheit und hilft vor allem dann nicht weiter, wenn es darum geht, Menschen in dieser Altersstufe helfen zu wollen. Erst recht wirkt sich diese Unsicherheit aber dann deutlich aus, wenn die Hilfestellung im Rahmen der Allgemeinen Beratung, Psychotherapie und Seelsorge (ABPS) geschehen soll. Um hier zu sicheren Aussagen zu kommen, wollen wir in einem neu aufgebauten Kurs die Grundlagen der ABPS bei Kindern und Jugendlichen anbieten. Es soll darum gehen, interessierten Beratern und Seelsorgern (und solchen, die es werden wollen), Eltern und Lehrern vor dem Hintergrund der Andersartigkeit von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung unseres ganzheitlichen Konzeptes die Unsicherheit zu nehmen und konkrete Hilfestellungen für die Beratung zu leisten.
Ich möchte im Rahmen dieses Artikels einige fundamentale Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen skizzieren und Ihnen dadurch die Notwendigkeit einer spezifischen Ausbildung vor Augen führen. Gleichzeitig erkennen Sie an diesen Skizzen bereits elementare curriculare Bestandteile des neuen Kurses, denn wir werden anhand der Unterschiedlichkeiten im Kurs arbeiten.
Beginnen wir mit der Motivation der Kinder und Jugendlichen. Wenn ein Erwachsener in die Beratung kommt, dann können wir in der Regel davon ausgehen, dass ein gewisses Maß an innerem Leidensdruck vorliegt, der ausreicht, dass er Hilfe sucht (ich werde im Folgenden keine gesonderte Geschlechterbeschreibung vornehmen). Erwachsene kommen von alleine, Kinder und Jugendliche werden in der Regel gebracht. Sie wollen nicht, zumindest meistens.
Wir wissen aus der Psychologie, dass eine elementare Voraussetzung für Lernprozesse die Motivation ist. Am besten intrinsische. Diese liegt in der Regel bei einem Kind oder Jugendlichen, zumindest zu Beginn der Beratung, nicht vor. Das macht eine ganz andere Zugangsweise notwendig, die aber gleichzeitig Voraussetzung für den therapeutischen Erfolg ist. Wir müssen Motivation aufbauen, die (noch) nicht da ist. Über diesen Umstand werden wir im Kurs intensiv nachdenken und Lösungsansätze aufzeigen.
Aus diesem Umstand entwickelt sich unmittelbar das nächste Problem. Weil die Erwachsenen in der Regel selbst motiviert in die Beratung kommen, sehen sie im Berater zumindest eine potentielle Hilfe (sonst würden sie ja nicht hingehen). Das ist bei Kindern und Jugendlichen anders. Weil sie in der Regel nicht gerne in die Beratung kommen, wird jede Tätigkeit des Beraters als Eingriff in die eigene Souveränität begriffen. Der Berater wird sozusagen zum „Gegner“, oder wird zumindest äußerst misstrauisch beäugt. Wir müssen deshalb einen pädagogischen Bezug schaffen, der (noch) nicht vorliegt. Auch dies werden wir im Kurs intensiv betrachten.
Kommen wir zu einem weiteren Unterschied: Der Erwachsene, der in die Beratung kommt, hat ebenso wie ein Kind oder Jugendlicher zwar auch ein Problem, aber unabhängig davon, wie schwer es wiegt, so hat er auf jeden Fall bereits ein höheres Maß an Lebenszeit „auf dem Buckel“. Und zwar immerhin eine so erfolgreiche Lebenszeit, dass er bis dato gelebt hat. Ein Kind oder Jugendlicher hat keine so lange Zeit hinter sich. Es fehlt ihm Lebenszeit und dadurch – wenn nicht gar qualitativ, so doch zumindest quantitativ – Lebenserfahrung. Er weiß einfach weniger über die Welt. Das führt dazu, dass er seine psychischen Probleme immer in den Kontext einer allgemeinen Verunsicherung über die Welt an sich, und wie es sich in ihr leben lässt, bringt. Und zwar unabhängig davon, ob diese Unsicherheit in einer effektiven Verbindung zum jeweiligen psychischen Problem steht, oder nicht. Mit anderen Worten: die anthropologische Unsicherheit der Kinder oder Jugendlichen ist in jedem Fall zumindest quantitativ erheblich größer als die eines Erwachsenen. Und das macht eine spezifisch anthropologisch geprägte Beratung notwendig. Dies bedeutet, wir müssen anthropologisch viel reflektierter und betonter vorgehen, als in der Erwachsenenseelsorge. Darüber werden wir im Kurs nachdenken.
Auch bei dem Seelenbegriff in der ABPS stoßen wir schnell auf fundamentale Unterschiede bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen, und zwar bei jedem der Faktoren. Nehmen wir zunächst die Spiritualität. Kinder und Jugendliche sind anders. Ob sich das direkt aus dem bekannten Spruch Jesu herleitet, „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes gelangen“, kann und will ich jetzt an dieser Stelle theologisch gar nicht ausarbeiten. Fakt ist, Jesus beschreibt eine Andersartigkeit (sonst müssten Erwachsene nicht werden, wie Kinder), und wir können getrost davon ausgehen, dass sich die Spiritualität von Kindern und Jugendlichen anders darstellt, als diejenige von Erwachsenen.
Auch die Physis ist anders. Kinder und Jugendliche haben einen anderen Körper- und Hormonhaushalt als Erwachsene, sie haben andere Kräfte (wer von den Erwachsenen ist schon so biegsam wie Kinder, welches Kind kann schon einen Kasten Bier anheben) und dies wirkt sich in vielfältiger Art auf die Wahrnehmung und den Umgang mit psychischen Problemen aus. Wir Erwachsene haben auch hinsichtlich der Psyche eine ganz andere Sicht von Problemen. Ohne hier bereits allzu tief in die Fachlichkeit einzusteigen, können wir dies beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Denkentwicklung (vgl. z.B. Piaget) oder dem Umgang mit altersspezifischen Entwicklungsaufgaben (z.B. Havighurst) schnell nachvollziehen.
Fazit: Wir müssen die spirituellen, psychischen und somatischen Entwicklungsstufen und Unterschiedlichkeiten von Kindern und Jugendlichen kennen, um tatsächlich substantielle Hilfe zu leisten.
Je länger man mit solchen Andersartigkeiten konfrontiert ist, umso größer wird der Respekt vor der Andersartigkeit bei Kindern und Jugendlichen und demzufolge der Notwendigkeit einer spezifischen Vorbereitung auf die Herausforderungen, die Seelsorge mit Kindern und Jugendlichen mit sich bringt.
Wir laden Sie ein zu diesem neuen Einführungskurs in die Kinder- und Jugendberatung. Termine: 19.-205.10(Teil I) und 16.-17.11.2018 (Teil II), jeweils Freitags von 14:00 – 19:00 Uhr und Samstags von 09:00 bis 16:30 Uhr. Ort: Evangelische Nord-Ost-Gemeinde, 60316 Frankfurt
Dr. Jörg Dieterich, Jahrgang 1968, verheiratet, zwei Kinder (6, 10). Derzeitig Studiendirektor im Bereich Sozialpädagogik an der Justus von Liebis Schule in Überlingen. Langjähriger Leiter der Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche am damaligen IPS in Freudenstadt. Vertretungsprofessor für Pädagogik an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe
Seelsorgerliche Beratung in BTS Gruppen – Nötiger denn je!
„Gerne würde ich mich in der Gruppe persönlich verabschieden und den Gruppenteilnehmern dazu gratulieren, in welcher Goldgrube sie gelandet sind.“
Diese Antwort bekam ich von einem ehemaligen Gruppenteilnehmer, der nun wieder ohne die Hilfe in der Gruppe in seinem Alltag zurechtkam. Aus beruflichen Gründen war es ihm nicht möglich, sich in der Gruppe zu verabschieden. Diese Botschaft an die Gruppenteilnehmer war ihm aber wichtig.
Er beschrieb sein Erleben dort mit: Ich habe den Eindruck, dass ich in der Gruppe gigantisch viel gelernt habe und glaube auch, dass ich so manches in meinem Leben umsetzen konnte. Ich habe es bisher nirgendwo anders erlebt, wie mir zugehört wurde und ich in meiner Situation ernst genommen wurde und eben auch herausgearbeitet wurde, was die eigentlichen Knackpunkte sind. Es ist nicht so, dass meine „nackten Stellen“ nicht mehr da sind, ich habe sie aber kennen gelernt und kann besser mit ihnen umgehen.
Was ist denn im Gruppensetting so anders als im Einzelsetting?
Die BTS Gruppe ist ein soziales System, das auf kleinstem Raum das tägliche Umfeld mit all seinen Facetten abbildet. Das bedeutet: Hier sind Menschen mit verschiedenen beruflichen Anforderungen in unterschiedlichen Hierarchiepositionen, im Alter von nach der Adoleszenz bis …., mit überkonfessioneller Gemeindezugehörigkeit, verschiedenster familiärer Prägungen und vielfältigsten Lebenszielen.
Dadurch bringen diese Menschen verschiedenste Ressourcen, Schwierigkeiten, und Probleme in den Gruppenprozess ein. Viele Ratsuchende denken: „ich habe mit meinen Problemen so viel Not, ich kann nicht auch noch die der Andern anhören“. Aber das Erstaunliche ist, dass die Menschen dadurch selbst gesünder werden, sie hören nämlich auf, nur um sich selbst zu kreisen! Andere leiden auch – eine wichtige Entdeckung!
Verhaltensänderungen können in der Gruppe geübt werden, z.B. mit Rollenspielen oder sonstigen interaktiven Vorgehensweisen. Das Ausprobieren in der Gruppe (geschützter Raum) erleichtert das Lernen von neuem Denken und Verhalten, weil die Angst vor den Konsequenzen von Fehlern stark reduziert wird.
Wenn ein neuer Gruppenteilnehmer hört, wie andere berichten, dass sie nach einer aussichtslosen Lebenslage wieder mit dem Alltag zurechtkommen, blüht die bei ihm die Hoffnung auf!
Eine BTS-Gruppe ist geradezu ideal, um die Betroffenen zu schulen. Die Teilnehmer lernen Merkmale von Störungen kennen (Depressionen, Ängste, …) und den Umgang damit. Sie erfahren etwas über Verschiedenheiten von Persönlichkeiten, vom Belohnungssystem im Gehirn, u.v.a.
Durch das Arbeiten in der Gruppe lernen die Teilnehmer eine für sie vorteilhafte Kommunikation, Wertschätzung, gute Streitkultur und damit eine reife soziale Kompetenz
Gruppenmitglieder halten zusammen, denn sie alle haben erfahren, dass sie einander nichts mehr vorspielen müssen. Sie merken, dass es gut tut, einen Raum zu haben, wo keine Maske mehr notwendig ist.
Für die BTS Gruppe gilt die biblische Verheißung, dass Jesus durch den Heiligen Geist mitten im Geschehen als Tröster und Helfer dabei ist.
Natürlich stimmten die Bedenken, dass die/der Einzelne nicht die ganze Aufmerksamkeit des Seelsorgers/Beraters erhält. Zwar sind die Nöte der RS individuell verschieden, trotzdem wird jeder Ratsuchende mit in den Veränderungsprozess einbezogen. Vielleicht gerade dadurch, dass er seine Bedürfnisse einfordern muss. Ein anderer muss lernen, sich nicht all zu wichtig zu nehmen.
Im normalen Alltag können wir uns auch nicht alle Situationen, Begegnungen, Umstände und Herausforderungen aussuchen. In der „alltagsnahen“ BTS-Gruppe, können wir lernen, wie wir mit all diesen Anforderungen besser umgehen können.
Eine weitere große Stärke des Gruppensettings ist die Stabilisierung nach einer stationären oder ambulanten Intervention. Beziehungserfahrungen in der Gruppe ermöglichen eine weitere Vertiefung des bisher Gelernten (Übung).
Diese Ergebnisse zeigen, dass das Gruppensetting ein sehr effektives Beratungssetting ist. Ist das nicht auch ein Setting, das Sie angehen wollen?
Natürlich brauchen GruppenleiterInnen Fertigkeiten und Wissen. Die BTS bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten an, damit Sie die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben können. Das sind: Grundkurs und möglichst die Aufbaukurse, Besuch des Gruppenmoduls (SA 03), Studium des Gruppenhandbuchs und des Gruppen Lehrfilms. In der Gruppenleitersupervision steht dann die Praxis dieses Settings im Mittelpunkt. Sie dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fähigkeit des Gruppenleiters.
Ich erfahre leider oft hinterher, dass sich Gruppen wieder schnell auflösen, ohne dass nach Hilfe und Unterstützung gesucht wurde. Besser wäre es in solch einem Fall, die Situation in der GLSV oder im Gespräch mit uns, Manfred Illg und/oder Lieselotte Beißwanger, zu besprechen.
Manfred Illg
Supervisor & BTS Gruppen
Lernen im (Berufs)Alltag
Wenn ich überlege, welchen Satz ich in den letzten 25 Jahren Beratungspraxis am häufigsten gehört habe, wenn es um Lernschritte und Veränderung ging, dann dieser: „Das ist aber nicht so einfach, Herr Mehring.“ Nein, gewiss, Veränderung ist nicht einfach. Aber ist es denn so schwer, wie diese Ansage vermuten lässt? Ich meine nicht.
Unsere Aufgabe in der seelsorgerlichen Begleitung muss sein, den Veränderungsprozess so anzuregen, zu begleiten und zu konzeptualisieren, dass der Weg für den Ratsuchenden als gangbar erkennbar und entsprechend begleitet wird. Da sind wir als Seelsorgerin und Seelsorger gefordert. Auf Seiten des Ratsuchenden braucht es Motivation. Das ist klar und das wissen wir alle. Ohne Motivation gibt es keine Veränderung.
Ich denke, dass wir ohne Mühe sagen können, dass Motivation ebenso wichtig ist wie die Intelligenz eines Menschen, um im Leben klar zu kommen. Motivation als Wille, Antrieb, das Gefühl der eigenen Wirkmächtigkeit, etwas machen wollen und können und es schlussendlich auch tun, speist sich einerseits aus der Frustration über den Ist-Zustand und andererseits aus der empfundenen Sinnhaftigkeit des anzustrebenden Ziels.
Ohne Frustration wird es keine Veränderung geben. Ohne Leidensdruck macht der Mensch sich nicht auf den Weg. Klingt profan – wird aber in aller Regel zutreffend sein. Natürlich haben wir theoretisch das Zeug auch ohne Leidensdruck Veränderung anzustreben. Einfach deswegen, weil wir uns Gedanken gemacht und etwas als die bessere Variante entschieden haben. Diese Variante gibt es sehr wohl. Aber die überwiegende Erfahrung aus dem seelsorgerlichen Kontext ist, dass wir uns erst dann, wenn wir auf „brennendem Boden stehen“, in Bewegung setzen. Leidensdruck der in diesem Sinne wirksam ist, kann man schlecht von außen induzieren. Wir können aber in der Seelsorge darauf hinweisen und hinwirken, dass der Mensch sich seines Leidensdrucks erinnert, so dass die Veränderungsbereitschaft nicht zu schnell und zu früh wieder abflacht. Das ist gewiss ein schwieriges Thema, weil es naturgemäß unser Bestreben ist, den Leidensdruck möglichst bald zu beenden.
Des weiteren ist es die Sinnhaftigkeit des neuen Ziels, die uns motiviert den Weg der Veränderung zu gehen. Wird dieser Sinn nicht gefunden, wird die Motivation unbedeutend sein und in aller Regel schnell und nachhaltig verflachen.
Was wird mir mein neues Verhalten im Kollegium bringen ? Wie wird es sich anfühlen ohne 5 Bier am Abend und 30 Zigaretten über den Tag verteilt zu leben ? Wie gut werde ich mich fühlen, wenn ich 2 x in der Woche Sport gemacht habe ? Wie sehe ich im Spiegel aus mit 10 Kg weniger ?
Es ist im Grunde wie bei einem Kassensturz. Was bringt mir die Veränderung ? Was bringt es mir, wenn alles so bleibt wie es ist ? Ohne sinnstiftende Verknüpfung, die gleichsam eine emotionale Verknüpfung mit dem Veränderungswunsch oder Lernziel darstellt, wird die Bemühung vor allem eines sein; anstrengend. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann das Unterfangen wieder eingestellt wird. Und damit gleichsam als negative Erfahrung konditioniert ist. Nach dem Motto „es war ja klar, dass ich es nicht schaffen kann“.
Neben diesen Aspekten ist als weiterer wichtiger Faktor die soziale Unterstützung zu nennen. Veränderung ist leichter, wenn man mindestens ein wenig Unterstützung in und durch sein Umfeld erfährt. Daher ist es durchaus empfehlenswert seinem engeren Umfeld von seinem Veränderungswunsch zu erzählen. Auch wegen des daraus resultierenden sozialen Drucks. Beispiel; doofe oder anspornende Kommentare, wenn man doch wieder eine Zigarette anzündet.
Vor dem Hintergrund dieser Aspekte ist es dann nur noch die Frage, wie klein oder wie groß man die Lernschritte dimensioniert. Weder sollen sie über – noch unterfordern.
Didaktisch in kleinst möglicher Form zusammengedampft kann man das Procedere des nachhaltigen Lernens im Dreiklang Verstehen – Entscheiden – Trainieren zusammenfassen. Eine Formel die man gut mit in den Alltag nehmen kann.
Oder man geht den etwas umfänglicheren Weg und lernt die Einzelaspekte des ABPS Veränderungsmodells als innere Landkarte auswendig. Stimuli – Gedanken – Medikamente – Organismus – Spiritualität – Verstärker – Kontingenz – System – Übung.
Diese Landkarte hilft, sich auf der Wegstrecke des Veränderns und Lernens zurecht zu finden und das Ziel zu erreichen.
Abschließend noch ein Punkt der mir nach den vielen Jahren in der Beratungspraxis immer wichtiger wird. Römer 12,2 wird in verschiedenen Bibelübersetzungen verschieden übersetzt. In manchen Übersetzungen lesen wir sinngemäß „verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes“. In manchen Übersetzungen lesen wir hingegen sinngemäß „werdet von Gott verändert durch die Erneuerung eures Sinnes“.
Streng genommen ist es ein gewaltiger Unterschied ob ich verändert werde durch Gott oder die Aufforderung an mich ergeht, mich zu verändern. Als Nicht-Theologe nehme ich an, dass beide Arten der Übersetzung aus dem Grundtext übersetzbar sind, also dem Bedeutungsspektrum der Worte entsprechen.
Und so wird aus dem vermeintlichen Gegensatz das ganzheitliche Ganze.
Wie auch an anderen Stellen des Wortes Gottes. Beides stimmt. Gott hilft. Und ebenso sollen wir selbst mit der uns eigenen Kraft und Motivation ans Werk geben.
Oder anders ausgedrückt. Es stimmt was immer schon stimmte und auch für unser Thema Veränderung zutreffend ist – Ora et labora.
Florian Mehring, MSc Psych. / BTS Wuppertal